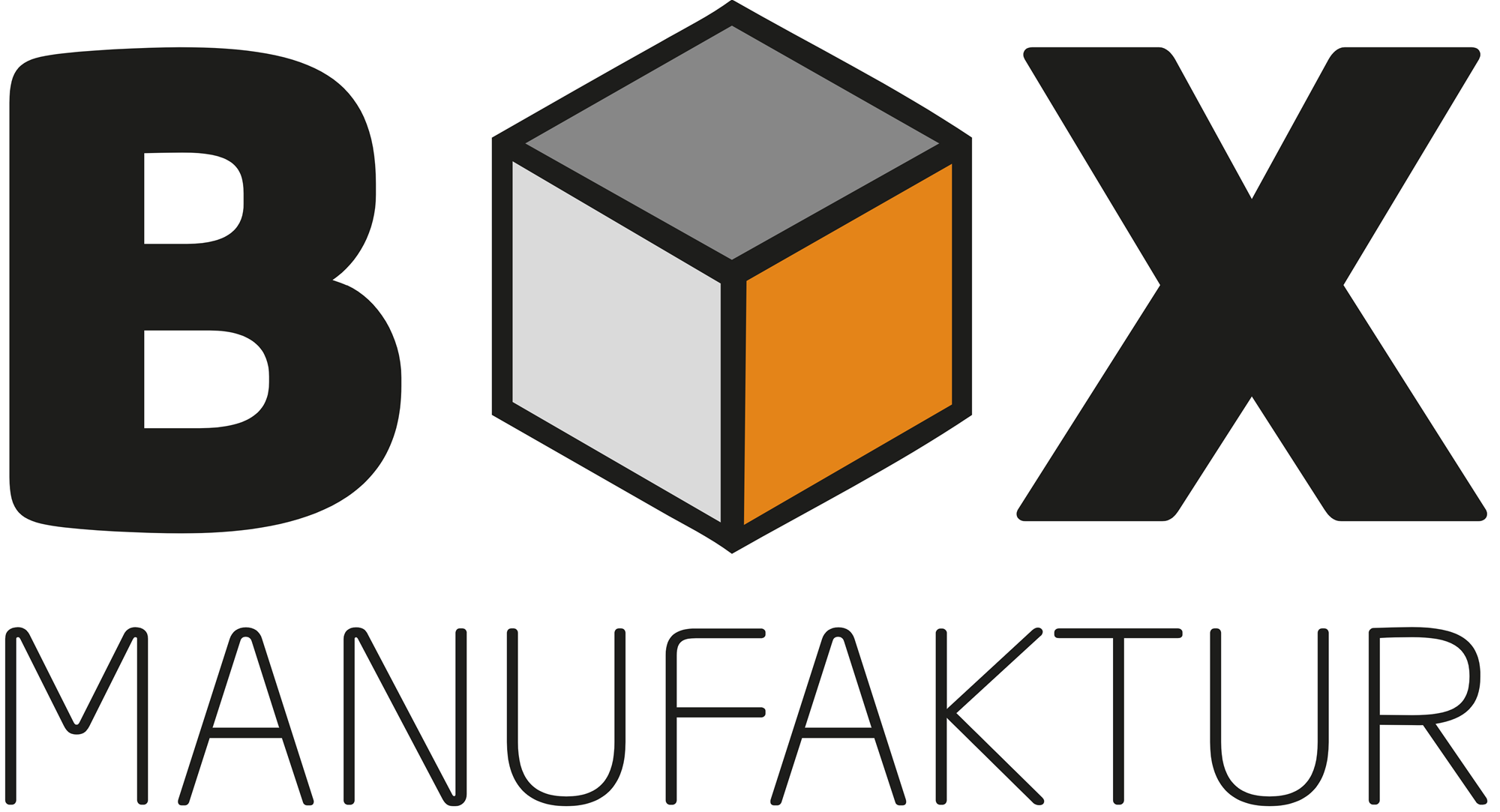Optimale Ausbeute

Holz lässt sich mit minimalem Energieaufwand und praktisch ohne Materialverlust spalten. So kann man den Rohstoff zerkleinern, ohne die steifen und festen Fasern anzuschneiden. Zu Platten verleimt, sollen aus solchen Holzstäben belastbare Werkstoffe produziert werden. Dies ist auch aus Sortimenten geringerer Qualität und mit verschiedenen Holzarten möglich.
Traditionelle, gespaltene Schindeln dienten für die neuen Holzwerkstoffe als Vorbild. Ein Team der ETH Zürich sowie der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Empa engagiert sich für die Entwicklung der Platten. Sie sollen aus heimischem Laubholz produziert werden, das bisher hauptsächlich zur Energieerzeugung verbrannt wird. Zukünftig werden in den Schweizer Wäldern trockenheitsresistentere Laubhölzer eine grössere Rolle spielen.
Spalten für maximale Ausbeute
Um auch längere Laubhölzer spalten zu können, setzen die Forschenden auf einen zweistufigen Prozess. Zunächst werden flächige Elemente getrennt, die anschliessend zu Stäben in der gewünschten Abmessung weiterbearbeitet werden. Dieser Vorgang wird im Labor mit der Einrichtung zum Spalten von Energieholz ausgeführt.
Mit künstlicher Intelligenz
Das unregelmässig gewachsene Holz stellt aber eine Herausforderung dar. Deshalb erfasst ein automatisiertes Kamerasystem hochaufgelöste Bilder jedes Holzstabes. Anschliessend bestimmt künstliche Intelligenz (KI) wichtige Holzeigenschaften wie die Steifigkeit für jeden Stab, unabhängig von Form, Grösse oder Holzart. Die ersten der ressourceneffizienten Platten wurden bereits gepresst. Ihre mechanischen Eigenschaften zeigen viel Potenzial.
Statt Spalten Quetschen?
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt «Long Beach» der Berner Fachhochschule. Hier werden qualitativ ungünstige Holzsortimente gequetscht und anschliessend zu Platten verleimt. Auch bei diesem Verfahren behalten die Faserbündel ihre natürliche Festigkeit und die Holzausbeute liegt nahe bei 100%.